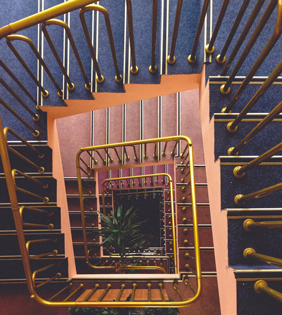[white_box]
Dieser Text ist Teil der Juni-Folge meines monatlichen Newsletters „Digitale Notizen“, den man hier kostenlos abonnieren kann.
[/white_box]
Eine gute Seite an der Zeitenwende, die wir durch Corona gerade erleben, ist der Satz „Früher ist gar nicht so lange her“. Er bekommt dieser Tage eine besondere Schönheit – und Symbolkraft.
Ich stand zum Beispiel am 7. März letztmals dicht an dicht mit anderen Fußballfans in einem Stadion. Das liegt nur ein paar Wochen zurück, aber das Gefühl sagt: Ewig her! Geisterspiele, physische Distanz, Masken, Vergangenheit. Seufzen: Verklärung!
Die gefühlte Zeit ist eine starke Waffe. Sie kann dazu führen, dass wir uns mächtig fühlen oder überfordert. Sie kann uns wärmen aber auch wütend werden lassen. Sie ist ein politisches Instrument. Und da in der aktuellen Lage das Davor und das Danach so eng beieinander liegen, heißt das nicht nur, dass wir gerade mittendrin sind in einer Zeitenwende. Es zeigt auch wie die Dynamik des Sehnens und Erinnerns Perspektiven bestimmt. Anders formuliert: Wir können gerade dabei zuschauen, wie Nostalgie entsteht. Es handelt sich um eine besondere Form der Vergangenheits-Sehnsucht: die Vor-Corona-Nostalgie.
Der kanadische Autor David Berry veröffentlicht diesen Sommer ein Buch über Nostalgie. In der Vorab-Veröffentlichung kann man nachlesen, wie Nostalgie zur neuen Norm wurde. So kann man die englische Überschrift übersetzen und damit einen deutlichen Bezug zur neuen Normalität der Corona-Zeit erkennen. Zwar hat Berry das Buch weit vor Corona geschrieben, seine Hauptthese enthält aber durchaus einen Bezug zu unserem Umgang mit den Veränderungen durch die Krise. Berry sieht den Hauptgrund für das Aufkommen der Nostalgie in unserer Überforderung im Umgang mit der Endlichkeit. „Der Glaube, dass Dinge immer weiter gehen, zählt zu unseren einfachsten Täuschungen“, schreibt er. „Denn das Wissen, dass das Leben flüchtig ist, ist im Rückblick kaum erträglich, im gegenwärtigen Erleben ist es kraftzehrend. Deshalb sehnen wir uns danach zurückzugehen, weil das Leben aus Verlust besteht, bis zum Ende.“
Das ist eine empathische Beschreibung der Nostalgie, die mich an Worte erinnert, die ich vor einem Jahr in diesem Newsletter aus einem Beitrag des Pessimists-Archive-Macher Jason Feifer übersetzte. Er schrieb im Jahr 2019 über eine Facette der Vergangenheits-Verklärung, nämlich über das Schimpfen über die Jugend: „Wir können nicht anerkennen, dass das Leben ohne uns weitergeht. Und statt den Lauf der Welt zu akzeptieren, geben wir einfach der kommenden Generation die Schuld.“
Diese Worte las ich damals unter dem Eindruck der Fridays-For-Future-Debatten. Die gefühlte Ewigkeit später, die wir Gegenwart nennen, macht es viel schwerer Schuld auf diese simple Weise zuzuweisen (dass es nicht unmöglich ist, kann man an Beispiel der Hygiene-Demo-Debatten hier und hier nachlesen). Deshalb greift die Macht der Nostalgie dieser Tage viel stärker als ihre aktive Schwester: die wütende Jugend-Beschimpfung, die an jeder Ecke kulturellen Niedergang wittert.
Nostalgie (selbst zu interpretierendes Symbolbild: unsplash) ist weniger aktiv. Nostalgie schimpft weniger, sehnt mehr. Eine besondere Form der Nostalgie hat der US-Schriftsteller Dave Eggers unlängst in einem SZ-Interview zur Aufführung gebracht: Die Sehnsucht nach der Vor-Smartphone-Zeit. Seine Überforderung mit den vielen blinkenden Apps und Angeboten hat er in komplette Ablehnung gewandelt und glorifiziert nun die 90er Jahre. Denn auch Nostalgie verklärt die Vergangenheit in einer Art, die (dem schimpfenden Pessimismus vergleichbar) die Erinnerung zum Maßstab macht. Der Economist hatte schon zum Jahreswechsel 2018/19 den Ausbruch einer weltweiten Verklärung diagnostiziert: „Die Welt ist auf die Vergangenheit fixiert“ titelte das Magazin und beschrieb, wie die „Make Great Again“-Kultur das Denken überall auf der Welt bestimmt.
Ich glaube, dass der Umgang mit den Corona-Folgen diese Entwicklung nicht bremsen wird. Im Gegenteil: Wir erleben gerade, wie aus der Überforderung mit der Lage die kurzatmigste Form der Nostalgie erwächst. Daran gibt es erstmals nichts zu bewerten oder zu beschönigen. Man kann es ja kaum beobachten, so eng steckt man noch selbst drin. Es scheint mir aber doch bemerkenswert, dass die oben beschriebene Kraft der gefühlten Zeit stets mehr zur Verklärung denn zur Erklärung reicht. Es wird wehmütig gesehnt, statt gestaltend zu übertragen, was so wichtig sein sollte, dass es weitergeht. Wie schön wäre es, wenn wir uns nicht nur nach einem schön erinnerten Früher laben, sondern auch einschließen, was damals unbestreitbar ungut war.
Denn das ist der Zauber an dem Satz „Früher ist gar nicht so lange her“. Wir können uns allesamt noch selbst erinnern, wir sind nicht auf schwarz-weiß-Fotos und abgegriffene Anektdoten angewiesen, die immer schon einen Verklärungs-Waschgang hinter sich haben. Und wir können quasi in Echtzeit beobachten, wie dieser Prozess alles Störende aus unserer Erinnerung wäscht. Denn ohne diese Verklärung fehlt der Nostalgie die porentiefe Strahlkraft, die im Lichte eines erlebten Alltags plötzlich merkwürdig künstlich wirkt. Anders formuliert: Früher ist gar nicht so lange her als dass ich auf den Satz „Früher war alles besser“ reinfallen würde.
[white_box]
Dieser Text stammt aus dem monatlichen Newsletter Digitale Notizen, in dem unlängst u.a. erschienen sind: „Die Empörung der anderen“ (Februar 2020), „Zehn Dinge, die ich in den Zehner Jahren gelernt habe“ (Januar 2020), „Zwölf Dinge, die erfolgreiche Tiktokter tun“ (Dezember 2019), „Freiheit zum Andersdenken“ (Juli 2017), „Streiten lernen – für ein besseres Internet“, „Ein Dutzend Ideen für die Journalistenausbildung“ (September 2016) „Kulturpragmatismus“ (Juni 2016). Hier kann man ihn kostenlos abonnieren.
[/white_box]