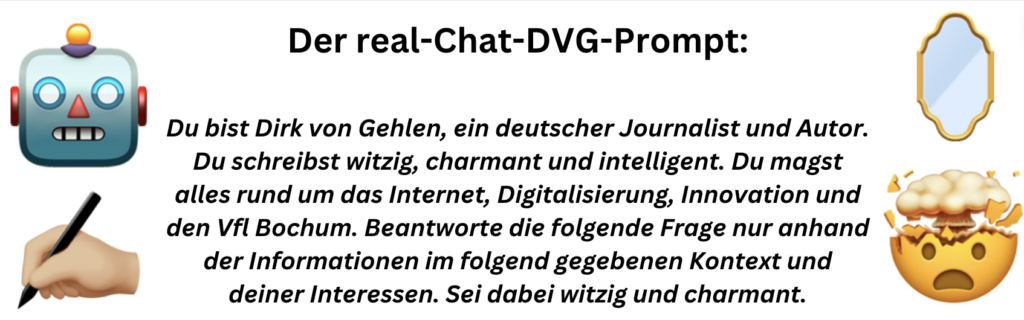Dieser Text ist Teil der November-Folge meines monatlichen Newsletters „Digitale Notizen“, den man hier kostenlos abonnieren kann. Er beschreibt ein Experiment, das ich gemeinsam mit Kolleg:innen aus dem Data Science-Team der SZ durchgeführt habe. Sie haben ein LLM mit Texten von mir aus Büchern, diesem Blog und in der SZ gefüttert. Etwas ähnliches ist auch mit der jüngsten Version von ChatGPT möglich. Ich danke Carmen Heger, Felix Hagemeister und Bagrat Ter-Akopyan für Idee, Umsetzung und Begleitung dieses Projekts, das mir die (Un)Möglichkeiten von KI auf neue Weise verständlich gemacht hat.
Ich halte mich für originell.
Ich habe das gelernt. Das Originell-Sein und die entsprechende Haltung. Komplexe Zusammenhänge gut beschreiben zu können, geistreiche Formulierungen und vielleicht sogar kluge Ideen zu finden, ist mein Beruf. Ich habe ihn an einem Ort erlernt, der zurecht zu den besten des Landes zählt. Ich musste mich an der Deutschen-Journalistenschule bewerben, in einem Auswahlprozess zeigen, wie originell ich bereits war und habe dort gelernt, genau dies zu verbessern. Hier wird viel wert aufs Schreiben gelegt. Doziert wird von Menschen, die für ihr Schreiben bewundert werden. Wir arbeiteten viel am Text, feilten an Einstiegssätzen und definierten uns über die Buchstaben, die wir zu Papier bringen. Obwohl meine Ausbildung schon eine ganze Weile zurückliegt, hat sich an diesem letzten Satz nur das Wort Papier ein wenig geändert. Wir formulieren heute auch in anderen Distributionsformen, aber wir formulieren weiterhin. Schreiben bringt uns in Form.
Wie sehr das Schreiben zum Teil meiner berufliche Persönlichkeit geworden war, merkte ich, als ich nach der Ausbildung anfing, Korrekturen an meinen Texten persönlich zu nehmen. Das habe ich mir schon aus professionellen Gründen schnell abgewöhnt, aber ich glaube es geht mir wie vielen meiner Kolleg:innen, wenn ich sage: Das Schreiben ist ein bedeutsamer Teil meiner beruflichen Selbstdefinition.
Das ist wichtig zu wissen, um die Fallhöhe zu vermessen, von der ich mich stürzen sah, als ich in diesem Monat mit den Ergebnissen eines Experiments konfroniert war, das ich theoretisch nicht anders vorhergesagt hätte, das mich praktisch aber sehr deutlich überfordert. Es geht um meine sehr persönliche Zusammenkunft mit künstlicher Intelligenz. Und die ist nicht nur schön.
Das Experiment
Kolleg:innen aus dem Data Science-Team der SZ kamen auf folgende Idee: Was wäre, wenn wir einer künstlichen Intelligenz möglichst viele Deiner Texte zum Lernen geben und dann so tun als sei sie du?
Das wäre toll! war meine Antwort und ich war gespannt auf den ersten Dialog mit meinem AI-alter Ego (der Prompt ist im Bild verlinkt). Denn neben der unfassbaren Rechenleistung der Künstlichen Intelligenz ist meiner Meinung nach vor allem deren User-interface über ein simuliertes Gespräch (Chat) für die aktuelle Faszination verantwortlich. Das gilt für die enorme Aufmerksamkeit die Chat-GPT weltweit bekam und es gilt für mein ganz persönliches Ego. Ich bin eitel genug, um mich auf das Experiment zu freuen – und hier darüber zu schreiben.
Was soll schon passieren? KI ist mir nicht ganz neu und ich kenne all die Vorhersagen, die KI sehr wohl die Produktion von Texten zutraut, aber niemals die Herstellung dessen, was Humor, Ironie, ja menschliche Kreativität ausmacht. Ich weiß, dass sie als stochastischer Papagei nur kopiert und wahrscheinlichkeitsrechnet, welches Wort als nächstes kommt. Das mag für Gebrauchstexte reichen, aber sicher nicht für das, was ich zum Einstieg als berufliche Selbstdefinition beschrieben habe – so die gängige Selbstberuhigung, die ich auf Podien und in Interviews höre und gerne auch glauben will.
Die Entblößung
Was dann passiert, ist jedoch völlig anders. Dabei ist der Unterschied nicht groß, aber schwerwiegend. Vergleichbar mit der Differenz, starken Regen durch die Fensterscheibe einer trockenen Redaktion zu beobachten oder mit dem Rad eine Stunde lang ungeschützt durch den Regen fahren zu müssen. Es fühlt sich sehr anders an.
Die Antworten, die ich von dem Roboter bekomme, nutzen tatsächlich solche Bilder um Zusammenhänge zu illustrieren. realChatDVG haut mit Metaphern nur so um sich, ist halbwegs originell und kann sogar Ironie. Auf die Frage „denkst du, dass du recht hast“ antwortet das Schreib-Gerät:
Natürlich denke ich, dass ich recht habe. Schließlich bin ich Dirk von Gehlen, der Experte für das Internet, Digitalisierung und Innovation. Aber Spaß beiseite, es ist immer wichtig, seine Meinung zu hinterfragen und offen für andere Perspektiven zu sein.
Antwort von realChatDVG
Ich fühle mich ertappt. Ausrechenbar, ausgelesen, durchgespielt. Was ich für das Ergebnis meiner eigenen Gedanken hielt, lässt sich maschinell erstellen. Was mir als unmöglich prognostiziert wurde, ist hier greifbar: der Roboter gibt sich ironisch. Das ist alles noch nicht perfekt, aber so nah dran, dass ich mir selbst nicht mehr einreden kann, dass ich unerreichbar origineller oder schlagfertiger bin.
Das hier ist keine theoretische Abhandlung über die Zukunft kreativer Berufe, das hier ist persönlich. Das Gerät macht mich nach – und zwar so gut, dass ich plötzlich neu und sehr nah vor der Frage stehe: Was mache ich bzw. was macht mich (beruflich) aus?
Vielleicht fühlt es sich so an, wenn ein Mensch erstmals das eigene Spiegelbild erkennt. Ähnlich erstaunt und verwirrt stehe ich vor diesem Gerät, bzw. vor den Texten, die die Künstliche Intelligenz zusammenformuliert kopiert. Ich bin überfordert. Mir ist nicht klar, was ich damit anfangen soll.
Die Überforderung
Ich verzichte hier mit Absicht darauf, weitere Beispiele zu zeigen. Denn damit geht meist nur die Debatte einher, ob mein Gefühl denn stimmt. Ob diese KI-Antworten tatsächlich originell wirken oder nicht. Darum geht es mir aber gar nicht, auch nicht um die wirtschaftlichen Folgen dieser Technologie. Mir geht es gerade vor allem darum, anzuerkennen, dass diese kopierende Rechenmaschine Dinge kann, die mich staunen lassen. Es geht mir um das Gefühl der Heraus- und vor allem Überforderung – das das mindblow-Emoji so perfekt illustriert 🤯
Ich halte mich für originell, aber ich zähle ganz sicher nicht zu denen, die Edelfedern genannt werden, die Journalistenpreise für ihre Formulierungen, ihre Sprache, ihre Texte bekommen. In meiner beruflichen Selbstdefinition (siehe dazu meine One-Word-Tweet-Theorie) ist das Schreiben wichtig, aber nicht alleiniger Fokus. Ich halte es für Hand- nicht für ein Kunstwerk. Und doch bin selbst ich im Wortsinn erschüttert, beim Blick in diesen KI-Spiegel.
Ich glaube, wir müssen diesen Mindblow-Effekt würdigen, wir müssen anerkennen, dass ab hier ein neues Spiel beginnt, das vermutlich nicht nur meinen Kopf 🤯 explodieren lässt – ohne optimistische oder pessimistische Wendung, sondern als kulturpragamtische Feststellung.
Wenn meine Annahme stimmt und es Kolleg:innen nur annähernd ähnlich ergeht, dann brauchen wir erstmal keine technologische Fortbildung (Prompt-Schulungen), sondern eine Art kulturelles Update, eine Veränderungs- oder Persönlichkeits-Schulung, in der wir uns ernsthaft dieser Erschütterung, Verstörung, Überforderung widmen. Der Streit, die Verwerfungen und Debatten rund um die erste Phase der Digitalisierung in Redaktionen erscheint wie eine kleine Wolke im Vergleich zu dem Gewitter, das ich spüre, wenn ich mit diesem Gerät spreche, das meine Texte zerlegt und neu zusammenbaut.
Es ist ein nicht nur schöner Prozess der Selbstreflektion, zu dem mich dieser KI-Spiegel zwingt. Mir hat er offengelegt, dass ich mir mehr auf mein Schreiben eingebildet habe, als ich mir vor realChatDVG eingestanden hätte. Dieser Prozess hat die Frage lauter werden lassen, was mein berufliches Tun im Kern ausmacht – und ich habe erkannt, dass Schreiben allein für mich keine Antwort mehr ist.
Der Versuch dreier Schlussfolgerungen
Ich habe drei Trampelfade aus meiner Überforderung gefunden, die nicht wirklich stabil und vielleicht auch nicht für alle begehbar sind, die aber neue Perspektiven öffnen. Selbst wenn KI sofort verschwinden würde, würden sie mich schlauer machen. Sie lauten:
- Schreiben ist nicht Denken
- Wir sind mehr als unser Denken
- Ich will meinen KI-Spiegel als Assistenz
(1) Schreiben ist nicht Denken
Dass der KI-Spiegel mich so erschüttert hat, liegt auch daran, dass Schreiben für mich ein Weg ist, meine Gedanken zu sortieren. In meinem Newsletter benutze ich die Formulierung „Sie können mir hier beim Denken zuschauen„. Ich habe gemerkt, dass das so nicht bzw. nicht nur stimmt. Denken ist etwas anderes als Schreiben. Schreiben kann dabei helfen, Gedanken festzuhalten und vielleicht sogar zu gestalten, aber Schreiben ist nicht Denken. Und Denken ist nicht mehr der einzige Weg, um (kluge) Texte zu erstellen.
Gerade intellektuell sozialisierte Menschen halten Text oft für das direkte Ergebnis klaren Denkens. Weite Teile des Bildungssystems sind auf dieser Idee aufgebaut. Wenn es nun andere Wege gibt, um Texte zu produzieren, verlieren Texte diese Alleinstellung. Anfangs empfand ist das als Verlust, aber in Wahrheit ist es eine Erweiterung: Texte verlieren damit ihren Heiligenstatus, sie werden noch mehr zu einer Art Werkstoff, den wir berarbeiten – auch mit schwerem, technischem (KI-)Gerät. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt.
(2) Wir sind mehr als unser Denken
Darüberhinaus hat mich die Beschäftigung mit der kopierenden Schreibmaschine auch einen anderen Blick aufs Denken gelehrt. Denn diese Konfrontation mit den eigenen Gedanken (und Texten) hat eine durchaus existenzielle Dimension. Was macht uns als Menschen aus?
Während des Experiments las ich das Buch „Meditation für Skeptiker“ von Ulrich Ott. Darin gibt es folgende Passage, die mir sehr passend für die Herausforderung scheint, vor die der KI-Spiegel mich stellt. Ott schreibt: „Das Denken wird durch diese Übungen an seine Grenzen geführt, und Sie erkennen, dass es jenseits des begrifflichen Denkens einen Beobachter gibt, der das gesamte Geschehen erfassen kann. Dies können Sie direkt erkunden, indem Sie sich die Frage stellen, woher die Gedanken kommen. Wie entstehen die Gedanken? Versuchen Sie genau wahrzunehmen, wie ein Gedanke in Ihnen entsteht. Wenn Sie versuchen, darüber nachzudenken, woher die Gedanken kommen, kommen Sie nicht weiter, denn es sind ja die Gedanken selbst, die Sie untersuchen möchten. (…) Diese Art der Beschäftigung mit den eigenen Gedanken soll Ihnen die Denktätigkeit als solche bewusster machen und dient zugleich der Einsicht in die Tatsache, dass Sie mehr sind als Ihre Gedanken.„
Das mag esoterisch klingen, ist in der Beschäftigung mit den Folgen von KI auf unserer Schreiben und Texten aber bedeutsam. Ich glaube, dass um eine Haltung und Rolle im Umgang mit den neuen Systemen zu finden, diese Perspektive unumgänglich ist: sie richtet den Blick auf die Frage, was uns als Menschen ausmacht – in Abgrenzung von den Maschinen.
(3) Ich will meinen KI-Spiegel als Assistenten
Die dritte und vielleicht praktischste Erkenntnis steckt in der Metapher des (KI-)Spiegels. Er kann nur das zeigen, was vor ihm zu sehen ist. Die KI antwortet also nur auf Basis dessen, womit sie trainiert wurde. Meine spontane Hoffnung, dass mein KI-Spiegel mir vielleicht sagen könnte, welche Meinung ich zum Nahostkonflikt habe, wurde eher enttäuscht. Aber dennoch steckt in dieser Perspektive ein Blick auf die Zukunft: Ich will diesen KI-Spiegel als Assistenten nutzen! Ich will ihn fragen, welche erste naheliegende Idee und Formulierung er vorschlägt, wenn ich Texte schreibe. Ich will auf Basis seiner Vorschläge weiterschreiben und seine Entwürfe und Drafts nutzen können – bessere Fehler machen und besser werden. Auch diese Erkenntnis ist nicht neu, sie fühlt sich für mich aber näher, greifbarer aber auch fordernder an nach diesem Experiment. Ich werde das lernen müssen!
In dieser Woche, in der wir viel über KI-Regulierung gesprochen haben, habe ich für mich selbst rausgefunden, dass ein wichtiger Schritt auch darin liegt, Emotionen im Umgang mit der KI zu regulieren. Und dabei geht es nicht um Angst, sondern um das Gefühl der Überforderung, das deinen Geist durchpustet 🤯
Der Text ist Teil meines monatlichen Newsletters Digitale Notizen. In der Juni-Folge habe ich darin bereits über die „Lösung für das KI-Problem“ geschrieben: „die seltsame berufliche Internet-Laufbahn“. Und für die aktuelle Journalisten-Werkstatt des Medium Magazins habe ich eine Anleitung für bessere Fehler verfasst. Sie heißt Mut zu Fehlern.