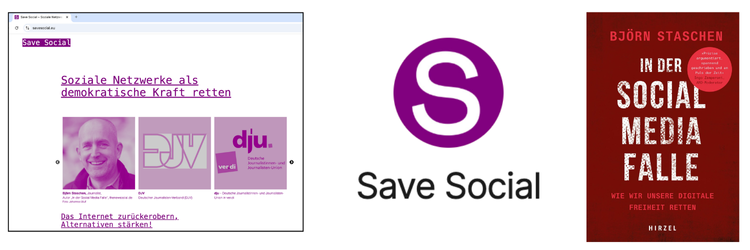Mein Freund Björn hat diese Woche für große und gute Aufregung gesorgt. Fast 40.000 170.000 Menschen (Stand Dienstag 18.2. 10 Uhr) haben sich dem Aufruf der Aktion „Save Social“ angeschlossen & hier auf campact unterschrieben. Das ist allein deshalb super, weil diese 40.000 170.000 Menschen Björns Buch „In der Social Media Falle“ zum Leben erwecken – und uns allen einen Weg heraus zeigen.
Sie alle erinnern uns daran, dass ein anderes Internet möglich ist. Dass wenige Großkonzerne an zentralen Schnittstellen bestimmen, nach welchen Regeln was und wo angezeigt wird, muss keineswegs der Normalzustand der digitalen Vernetzung sein. Im Gegenteil: als die grundlegende Infrastruktur des Internets gelegt wurde, ging es um etwas sehr anderes. Das Internet basiert auf dezentralen Strukturen, nicht-kommerziellen Verbindungen und der Hoffnung auf eine bessere Welt durch geteiltes Wissen. Nur weil sich diese Hoffnung (noch) nicht vollumfänglich eingelöst hat, ist sie dennoch nicht verloren. Ich glaube weiterhin daran, dass das Internet das größte Geschenk meiner Generation ist – und dass spätestens unsere Enkel nicht mehr verstehen, warum wir so lange zugelassen haben, wie Profite und Pessimismus uns den Blick darauf verstellt haben.
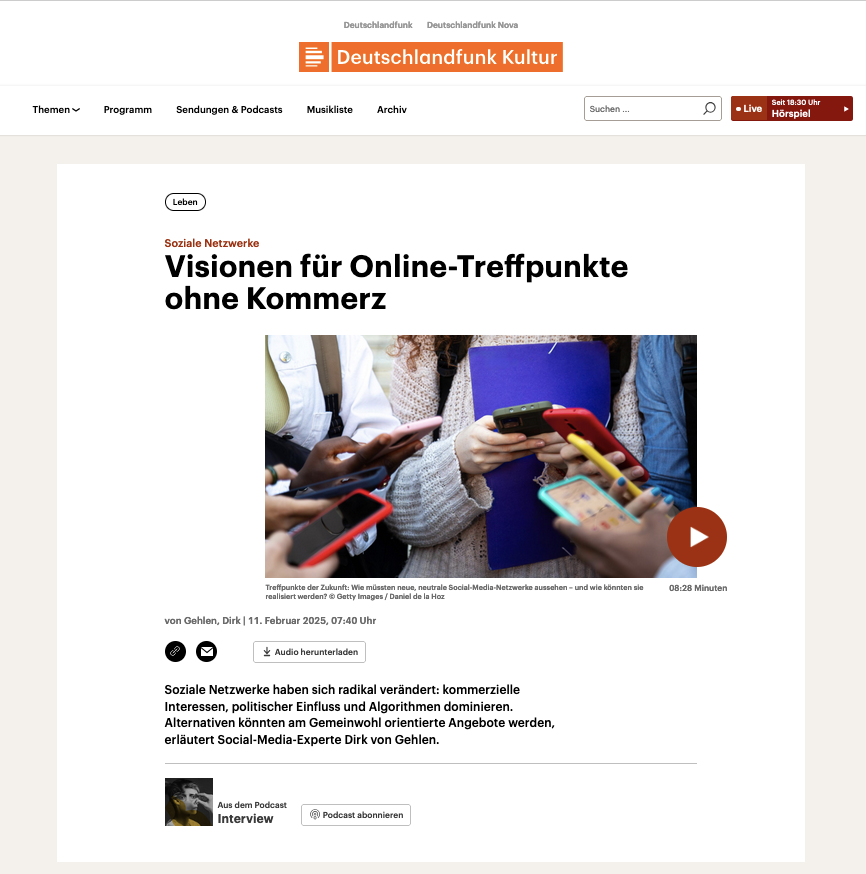
Ebenfalls in dieser Woche (kurz vor dem Start der Save-Social-Kampagne) durfte ich im Gespräch mit Dieter Kassel in Deutschlandfunk-Kultur der Frage nachgehen, was nach dem Web2.0-Zeitalter kommen könnte. Schon auf der republica2024 haben wir diese Frage besprochen – und nach Antworten für ein anderes Internet gesucht. Seit dem denke ich darüber nach, warum wir zwar alle wissen, dass es besser wäre, Facebook, Instagram, WhatsApp, Tiktok und X nicht zu nutzen und trotzdem nicht zu den Alternativen wechseln. Natürlich liegt das an fehlender Zugänglichkeit und mangelnden Vorbildern. Save Social setzt genau da richtigerweise an (wer ein Angebot in einem Walled-Garden anbietet, sollte das gleiche auch im freien Web zeigen!) – aber reicht das?
Ich glaube, damit Netzwerke funktionieren, müssen sie nicht nur funktional sein, sondern Spaß machen. Deshalb hier fünf halbfertige Gedanken für mehr Begeisterung für freie Angebote:
1. Netzwerke brauchen Momentum
Die perfekte Infrastruktur macht noch kein Erlebnis – das gilt für Kneipen und Konzerthallen genauso wie für Partys und Plattformen. Erst wenn die Menschen da sind, muss die Infrastruktur ihre Qualität beweisen. Sie in den Vordergrund zu stellen, gleicht dem Versuch, Menschen von einem Restaurantbesuch mit dem Argument zu überzeugen, dass die Toiletten dort das beste Abwassersystem haben. Das ist sicher ein bedeutsamer Punkt für ein Gasthaus, er wird aber nie die Freude am Essen und am Austausch mit Freund:innen ersetzen können. Und je häufiger er betont wird, umso mehr entsteht der Eindruck, dass das Essen dort vielleicht gar nicht so gut ist.
2. Ohne die Aufmerksamkeit der anderen entsteht kein Momentum
Im 25. Kapitel des Matthäus-Evangelium steht in Vers 29 ein wichtiger Satz über den Erfolg von sozialen Medien: „Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe; wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat.“ Dieser so genannte Matthäus-Effekt beschreibt, wie Netzwerke erfolgreich werden – und übrigens auch wie sie an Bedeutung verlieren können: über die Aufmerksamkeit der Anderen. Wenn wir das Gefühl haben, dass die anderen etwas wichtig finden, zieht das unsere Aufmerksamkeit an. Wir wollen dabei sein. Dieser Antrieb lässt Momentum entstehen und den großen kommerziellen Anbietern ist es immer wieder geglückt, diese Hypes zu befördern. Wir haben dann das Gefühl, bei einer besonderen Sache dabei zu sein. Das gelingt durch Verknappung von Zugängen oder durch das Aura-Gefühl, sich einer Gruppe zugehörig zu fühlen. Es basiert aber immer auf Emotionen und nicht auf reiner Vernunft.
3 „Wir haben Social-Network Zuhause“ ist kein Argument

Der Satz „Wir haben xyz Zuhause“ ist ein schönes Meme. Es basiert auf der elterlichen Annahme, ein z.B. vernünftiges Abendbrot daheim könne den kindlichen Wunsch nach einem Fast-Food-Burger ersetzen. Erfolgreiche Plattformen leben auch von dem Einsatz von Memes – auf Text-, Ton-, Bild- und vor allem Kultur-Ebene.
Meme-Literacy basiert nicht auf reiner Vernunft, nicht auf der abschließenden Überzeugung, das Richtige zu tun. Meme-Literacy lebt vom indirekten Sprechen, vom Kontext-Bruch und vom Humor, der mindestens ein Augenzwinkern braucht. Lediglich zu sagen, dass die Angebote im Fediverse doch alles haben, was die kommerziellen Plattformen bieten (was stimmt), bringt noch niemanden dazu, sie auch wirklich zu nutzen. Ich glaube, es braucht mehr Beispiele, die es einfach tun – ohne ständig zu betonen, dass sie es tun (weil es richtig ist). Oder anders formuliert:
4 Show don’t tell
Wir sollten weniger behaupten, dass ein anderes Internet möglich ist – und es mehr zeigen. Und zwar durch positive Vorbilder und durch eine konstruktive Grundhaltung. Ich würde mir deshalb weniger fingerpointing auf jene wünschen, die etwas falsch machen – und mehr Rückenwind für die Projekte, die auf dezentrale Strukturen setzen, Neues ausprobieren und selbstverständlich auf die kommerziellen Plattformen verzichten.
Um aus der aktuellen Lage herauszukommen, brauchen wir weniger Beweise fürs Rechthaben und mehr Versuche fürs besser werden. Ich habe diese Abkehr vom Perfektionismus, hier mal zu beschreiben versucht – und sie bezieht sich meiner Einschätzung nach nicht nur auf die eigene Lernreise, sondern auch auf den Weg raus aus der Umklammerung der kommerziellen Plattformen.
5 Kein kalter Reichweiten-Entzug
Der beste und auch gemeinste Trick der Plattformen war jener der Reichweite. Ich habe hier mal über das Follower-Dilemma geschrieben – und alle, die aktuell beruflich mit Social-Media zu tun haben, kennen das Problem: die Plattformen liefern eine Zahlengrundlagen, die zwar nicht nachprüfbar ist, aber zur Grundlage strategischer Entscheidungen herangezogen wird. Wenn nun eine alternative Plattform ganz ohne vermeintliche oder echte (interne) Reichweiten-Zahlen auskommt, ist das für all jene, die bisher nach dieser Grammatik in Netzwerken gearbeitet haben, eine große Herausforderung. Das Beispiel von Heise auf Mastodon zeigt, dass die zu bewältigen ist – sie ist aber nicht ganz so selbstverständlich wie bei den kommerziellen Plattformen
Hier kannst du den Save Social Aufruf unterschreiben!
Welche Hebel siehst du, um alternative Plattformen attraktiver zu machen? Schreib doch dazu in deinem Weblog! Wie beim Blogstöckchen-Versuch werde ich auch hier alle Blogeinträge zum Thema hier verlinken – Du kannst mir übrigens auch auf Mastodon Bescheid sagen
… Stefan Pfeiffer hat genau das gemacht – und auf diesen Blogeintrag hingewiesen
… das Projekt #SoSollWeb von Annette Schwindt verlinkt sehr viele spannende Beiträge zum Thema.
Björn erklärt im Medienwoche-Podcast Hintergründe zum Projekt